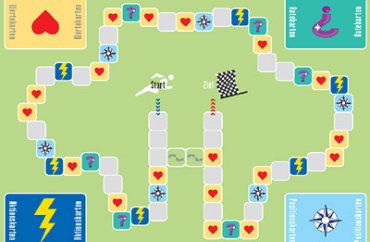Im Reich der Leistungsmessung
Gut, besser, am besten

Wer schaukelt am höchsten? Wer ist der Stärkste? Wer malt am schönsten? Schon im Kindergarten und auf dem Spielplatz interessieren sich die meisten Kinder brennend dafür, ihr Können mit dem von anderen zu vergleichen. Sie empfinden „Leistung“ und „Wettbewerb“ als Ansporn; manche möchten am liebsten jetzt schon wissen, welche Noten sie für ihre Leistungen bekämen (während die Grundschulen selbst in den ersten Klassen auf Noten verzichten). „Jetzt bin ich groß, bald kann ich lesen, schreiben und rechnen“: Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, mit dem sie zur Schule kommen, scheint unerschütterlich. Doch ziemlich bald schon bekommt dieses stolze Selbst-Bild Risse …
Denn in der Schule ist manches eben anders. Im Kindergarten lebte das Kind in einer bunten Gemeinschaft mit großen Altersunterschieden; jetzt gehört es einem augenscheinlich homogenen Klassenverband an, in dem sich Leistungen schneller und scheinbar besser vergleichen lassen. Dazu kommt: Anders als im Kindergarten zählen jetzt bestimmte Leistungen doppelt und dreifach und andere viel weniger. Dass Paul die Namen aller Autos samt Höchstgeschwindigkeit herunterrattern kann, ist in der Schule kein Ausgleich mehr für seine Schwierigkeiten beim Lesen … Ganz hoch im Kurs stehen beim Lehrer – und den eigenen Eltern! – offensichtlich Lesen, Schreiben und Rechnen. Anerkennung gibt’s auch fürs Malen und Radschlagen, Ärger dagegen fürs Trödeln beim Umziehen in der Turnhalle … Und plötzlich beginnt das Kind, sich und andere Kinder kritisch zu beäugen. Es registriert, welche Leistungen vom Lehrer und von Vater und Mutter kommentiert, vielleicht sogar kritisch bewertet werden. Diese Erfahrung kann an seinem Selbstbewusstsein kratzen; das Kind merkt, dass seine Selbstwahrnehmung nicht automatisch mit der der Erwachsenen, vor allem der der Eltern, übereinstimmt.
Viele Mädchen und Jungen kommen damit problemlos klar. Bei anderen müssen sowohl Lehrkräfte als auch Väter und Mütter aufpassen, dass die Freude am Lernen nicht jetzt schon unter der Enttäuschung über die eigenen Leistungen und die Vergleiche mit den „besseren“ Kindern versandet.
Guter Gott,
segne unser Schulkind,
dass es seine Freude an der Welt bewahrt und seine Neugier, sie zu erkunden, dass es in der Schule Menschen begegnet, die es wertschätzen und bei denen es sich wohlfühlt, dass es auch bei Enttäuschungen nicht den Mut verliert.
Und segne uns,
dass wir uns mit ihm über seine wachsende Selbstständigkeit freuen, dass wir gelassen bleiben und uns an seine Stärken erinnern, wenn ihm das Lernen schwer fällt, und dass wir nie vergessen, dass das Leben mehr ist als die Schule.
Der Lehrer wird dazu versuchen, diese Vergleiche zu entschärfen, indem er jedes Kind differenziert je nach seinen individuellen Möglichkeiten fördert. So kann die Freude über die eigenen Lernerfolge dafür sorgen, dass die schnelleren Fortschritte der „stärkeren“ Kinder die „schwächeren“ nicht zu sehr entmutigen.
Und die Eltern? Für sie kommt es zunächst darauf an, sich selbst zu hinterfragen: Welche Erwartungen habe ich an mein Schulkind? Muss es zu den „Besten“ seiner Klasse gehören? Habe ich Angst davor, dass es mit weniger guten Noten später keinen Erfolg im Leben hat? Übertrage ich diese Ängste und Sorgen auf mein Kind? Setze ich es damit unter Druck?
Vergleiche des eigenen Kindes mit „besseren“ helfen ihm genauso wenig wie verschärftes „Üben“ auf eigene Faust. Ob es wirklich Hilfe braucht und, wenn ja, welche, klären Väter und Mütter am besten im Gespräch mit dem Lehrer. Entscheidend bleibt jedoch die Frage „Wie definiere ich Erfolg und Misserfolg?“ Und: „Was ändert sich in der Beziehung zu meinem Kind, wenn die Misserfolge überwiegen?“ Denn der Umgang der Eltern mit Erfolg und Misserfolg beeinflusst maßgeblich, wie die Kinder selbst damit klarkommen. Sie ständig auf Fehler und Schwächen hinzuweisen („Das müssen wir noch üben!“), entmutigt sie nur.
Besser, die Eltern vermitteln ihnen: „Ich hab dich lieb! Und ich glaube an dich und sehe deine Stärken!“ Dann können sie freier und motivierter an ihre Aufgaben herangehen und auch an Misserfolgen wachsen.